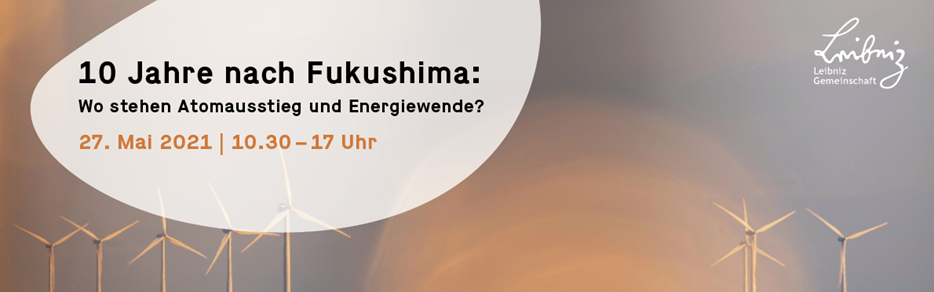Willkommen auf der Seite der "Textinitiative Fukushima"
Die Seiten der Textinitiative Fukushima werden derzeit von der Japanologie der Goethe-Universität betrieben. Gegenwärtiges Anliegen von TIF ist die zeitgeschichtliche Dokumentation. Das Forum dient nun in erster Linie als Archiv für Informationen zu 3/11 sowie allgemein zur Geschichte des Atomaren. Die Suchfunktion ermöglicht Recherchen zu Stichworten, Inhalten und Akteuren.
| Vortragsreihe "Japan’s Split Society Between Genbaku and Genpatsu: Media, Propaganda and Science" | 15.05.2021 |
Im Rahmen der von den Japanologien Köln und Leipzig organisierten Vortragsreihe des Sommersemesters 2021 wird es in den kommenden Wochen Beiträge japanischer Forscherinnen und Forscher auf Zoom geben. Als nächstes sprechen Yuka Tsuchiya (Kyoto) und Maika Nakao (Hiroshima) zu folgenden Themen: 3. USIS 映画と「ニュークリア」 土屋由香 教授 京都大学大学院総合人間学部人間環境学研究科 USIS Films and the Topic of the “Nuclear” 4.可視化/不可視化される放射線影響ー原爆被害をめぐる言説と表象 中尾麻伊香 准教授広島大学人間社会科学研究科 Making Radiation Effects (In)Visible: Discourses and Representations on Atomic-Bomb Victims |
|
| Podiumsdiskussion: 10 Jahre nach Fukushima - Atomausstieg und Energiewende? | 14.05.2021 |
"Am 11. März 2011 ereignete sich die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Der GAU in einem technologisch führenden Land und in einer demokratisch organisierten Gesellschaft wurde gravierend anders beurteilt als der Unfall in Tschernobyl und er traf auf eine ohnehin angespannte Lage. Der Anfang der 2000er Jahre erreichte Konsens über Sicherheitsanforderungen und Betriebsdauer der Atomkraftwerke war politisch aufgekündigt worden. Nur wenige Monate vor dem Reaktorunglück hatte die Bundesregierung die Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke deutlich verlängert. Die Lager waren tief zerstritten, der soziale Frieden war gefährdet. Zudem überlagerten wahltaktische Aspekte und finanzielle Konsequenzen die ethische Grundfrage nach den Risiken dieser Technologie. In diese Atmosphäre hinein berief Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel die Ethik-Kommission „Sichere Energieversorgung“. Für die Beratungen der Kommission war entscheidend, dass sie sich in Dutzenden von Gesprächen und in einer 11-stündigen öffentlichen Anhörung für die Positionen und Einsichten aller Stakeholder öffnete. Auf dieser Grundlage erarbeitete die Kommission ein einmütiges Votum. Am 30. Mai 2011 beendete die Kommission ihre Arbeit mit der Übergabe des Berichtes an Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Nun ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme am Runden Tisch, um die weltweite Aktualisierung der Diskussion um die Kernenergie anzuregen. Die Sitzung des Runden Tisches wird auf dem YouTube-Kanal der Leibniz-Gemeinschaft gestreamt. Leibniz-Gemeinschaft Chausseestraße 111, 10115 Berlin
|
|
| "The Correlation of Godzilla and the Atom" - Vortrag an der Japanologie Leipzig | 14.05.2021 |
https://japanologie.gko.uni-leipzig.de/event/lecture-series-2021-japans-split-society/ ゴジラとアトムの補完 ~1950年代の日本のマス・メディアにおける原爆と原発の関係~ 山本昭宏 准教授 神戸市外国語大学総合文化 The Correlation of Godzilla and the Atom – Associate Prof. Akihiro Yamamoto Kobe City University of Foreign Studies General Culture |
|
| Neue Meldungen vom havarierten AKW Tschernobyl | 14.05.2021 |
"Im Inneren des alten Sarkophags um den havarierten Reaktorblock 4 in Tschernobyl verfolgen Sensoren das Geschehen genau. Ihr besonderes Augenmerk gilt jenen Räumen, in die während des Unfalls im Jahr 1986 das lavaartige Gemisch aus geschmolzenem Kernbrennstoff, Steuerstäben und Trümmern geflossen ist. Einer dieser Räume: 305/2. In ihn ist damals besonders viel dieses Coriums geflossen. Und dort messen Sensoren seit vier Jahren ein Signal, das Experten Sorgen bereitet, erklärt der Neil Hyatt von der University of Sheffield." (Deutschlandfunk, 10. Mai 2021) |
|
| Wakamasu Jôtarô verstorben | 27.04.2021 |
Über den Japanologen u. Journalisten Andeas Singler erreichte uns die Nachricht, dass der aus Fukushima stammende Lyriker, Essayist und Anti-Atom-Aktivist Wakamatsu Jôtarô 若松丈太郎 am 21. April im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Dies berichten mehrere japanische Online-Portale und Zeitschriften: https://www.minpo.jp/globalnews/moredetail/2021042301001958
Wakamatsu wurde in der Kleinstadt Ôshû, Präfektur Iwate, im Nordosten Japans geboren. Nach seinem Studium an der Universität Fukushima und seiner Hochzeit zog er mit 28 Jahren nach Hara-machi (Stadt Minamisôma, Präfektur Fukushima). Er war Lehrer für japanische Sprache an High-Schools der Präfektur Fukushima und schrieb seit den 1960er Jahren Gedichte. Seit Inbetriebnahme der ersten Atomkraftwerke in Fukushima in den 1970er Jahren machte er auf die Risiken der Atomenergie durch Veröffentlichung von Zeitungsartikeln und Engagement in Bürgerinitiativen aufmerksam. Im Mai 1994 reiste Wakamatsu als Mitglied eines lokalen Anti-AKW-Bündnisses in die Sperrzone des acht Jahre zuvor havarierten Tschernobyl-Kraftwerks. Nach dem 11. März 2011 und der Havarie des AKW Fukushima Daiichi floh Wakamatsu mit seiner Frau kurzzeitig aus seinem 25 km vom Zentrum der Sperrzone entfernten Wohnort, kehrte nach einigen Wochen jedoch wieder zurück. Im Nachtrag: Auf seiner Webseite gibt es nun einen Beitrag von Andreas Singler zum Tode Wakamatsus - inklusive eines Interviews (2018): "Wie wenige andere verkörperte er die Ästhetik des Widerstandes: Jahrzehntelang hat Wakamatsu Jôtarô 若松丈太郎 (1935 - 21.04.2021) in Gedichten, Essays und Artikeln vor den Gefahren der Atomkraft gewarnt. Nach der Tschernobyl-Katastrophe sagte er ein ähnliches Ereignis für seine Heimat Fukushima immer wieder voraus. In einem Gespräch mit Andreas Singler aus dem Jahr 2018 gibt Wakamatsu Auskunft über seine Wurzeln im Japan des 2. Weltkriegs und seinen unbändigen Hang zum freien Denken" |
|
|
286-290 von 810
|